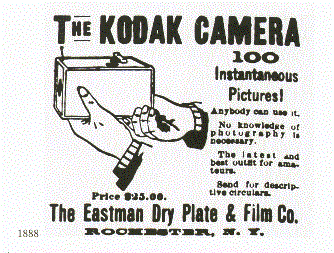Das Bild wird Bühne – Inszenierungen der Ferne
Eine Reisegruppe aus Deutschland in Gizeh. Heute befindet sich an der ungefähren Position des Fotografen ein KFC. Und ein Pizza Hut.
Mit der industriellen Revolution änderte sich das Reisen grundlegend. Der technische Fortschritt der Eisenbahn, ein wachsender Wohlstand der Mittelschicht und erstmals auch geregelte Arbeitszeiten öffneten den Horizont. Reisen war nun nicht länger das Privileg weniger, sondern wurde schrittweise zur Möglichkeit vieler. Thomas Cook organisierte in England erste Pauschalreisen: Er verhandelte Fahrpreise, kombinierte sie mit Unterkünften und legte damit den Grundstein für eine neue Form des Tourismus – die Pauschalreise, abgesichert mit Coupons und bald auch mit den Vorläufern des Reiseschecks. In Deutschland folgte bald ein Pionier: Carl Stangen aus Berlin, der als „deutscher Cook“ galt. Er organisierte Reisen zu den Pyramiden ebenso selbstverständlich wie zu den Niagara-Fällen oder zu Custers Schlachtfeld, mitten im Nirgendwo der amerikanischen Prärie.
Doch mit der neuen Mobilität kam auch ein neues Bedürfnis: das Erlebte mitteilen. Wer früher aus Italien Skulpturen, Münzen oder Gemälde mitbrachte, konnte nun nicht mehr so schwer beladen reisen. Es musste leichter, günstiger und zugleich repräsentativ sein. In diese Lücke trat - neben dem preiswertem Souvenir - die Postkarte.
Postkarte des Reise-Bureau’s Carl Stangen, datiert 24.7.1900
Ursprünglich in den 1860er Jahren als schmuckloses Kommunikationsmittel entworfen, entfaltete die Bildpostkarte rasch eine doppelte Wirkung. Sie war zum einen Verbindung nach Hause, eine kurze Nachricht, billiger als ein Brief. Zugleich war sie Abbild der Reise selbst. Eine Karte mit dem Eiffelturm, dem Rheinfall oder dem Matterhorn war mehr als bloß Papier: Sie war Beweis der Abwesenheit, Bezeugung der Ferne, fast schon ein kleiner Passierschein zur eigenen Weltläufigkeit. Der Absender dokumentierte nicht nur, dass er an einem Ort gereist war – er zeigte auch, dass er es sich leisten konnte. Carl Stangen nutzte die Postkarte frühzeitig als Werbemittel und Erinnerungsstück für seine Reisen: Zwar erfand er die Postkarte nicht – diese Ehre gebührt dem Österreicher Emanuel Herrmann im Jahr 1869 – doch er trug entscheidend dazu bei, dass sie sich als Medium des Reisens etablierte und sowohl Teilnehmer als auch die breite Öffentlichkeit erreichte, da er vorgefertigte Karten seinen Reiseteilnehmern mitgab, bevor eine lokale Kartenproduktion wie heute überhaupt existierte.
Der Soziologe Dean MacCannell nannte dieses Prinzip später „markers“: Objekte, die nicht nur ein Erlebnis bezeichnen, sondern es zugleich erst erschaffen. Die Postkarte war ein solcher Marker. Sie machte das ferne Schloss, die Brücke, den Wasserfall zum Reiseziel, indem sie als Bild in Umlauf ging. Was auf Karten abgedruckt war, gewann touristische Bedeutung – und Orte, die keine Postkartenmotive boten, verschwanden aus dem Blick.
Die erste Kodak, $25 mit 100 Aufnahmen.
Parallel dazu begann eine zweite Revolution: die private Fotografie. Mit der Kodak Kamera von 1888 wurde das Reisen nicht nur erlebbar, sondern auch dokumentierbar. „You press the button, we do the rest“ versprach der Slogan. Kodak lieferte die Kameras mit eingelegtem Film, der Kunde schickte das ganze Gerät zurück und erhielt seine Abzüge samt neu geladener Kamera zurück. Damit entfiel das komplizierte Entwickeln, das Fotografieren wurde massentauglich. Millionen Amateure wurden zu Chronisten ihrer Ferien – und bald zu Jägern bestimmter Bilder.
Reiseführer wiesen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf lohnende Fotopunkte hin: Sonnenaufgänge, Aussichtskanzeln, Wasserfälle. Während Mark Twain bei seinen Alpenreisen noch ironisch darüber klagte, dass er stets die beste Lichtstimmung verschlief, wartete eine Generation später schon eine ganze Schar von Hobbyfotografen auf genau diesen Augenblick.
Die Kamera wanderte überallhin mit: in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs, wo Soldaten heimlich Szenen festhielten, die die Militärzensur verschwieg; ebenso aber auch auf die neuen „Pilgerreisen“ zu den Schlachtfeldern. Der Krieg selbst wurde zum Ziel von Touristen, die zwischen den beiden Weltkriegen Verdun, Ypern oder die Somme besuchten – mit Fotoapparat, um die Stätten des massenhaften Sterbens in ein privates Andenken zu verwandeln.
Auch die Gesellschaft selbst veränderte sich. Zwischen den Kriegen entstanden erste Sozialgesetze, die einen bezahlten Urlaub regelten. In Deutschland institutionalisierten die Nationalsozialisten mit dem „Kraft durch Freude“-Programm diese Neuerung – Massenreisen an die Ostsee oder sogar nach Italien sollten den neuen „Volksgenossen“ prägen. In Frankreich, wo die Volksfront-Regierung ähnliche Regelungen einführte, machte sich erstmals auch die Arbeiterschaft auf den Weg in die Ferien. Freizeit wurde nicht länger nur gewährt, sondern gesetzlich zugesichert – ein Bruch mit Jahrhunderten sozialer Praxis.
Ein ikonisches Dokument dieser Entwicklung stammt von Henri Cartier-Bresson: Erster bezahlter Urlaub, Ufer der Seine bei Juvisy-sur-Orge, 1938. Auf dem Bild sieht man Familien, Paare, Freunde – Männer in Hemdsärmeln, Frauen in leichten Kleidern, Kinder, die lachen. Sie liegen auf Picknickdecken am Ufer, entspannt, als hätten sie sich diesen Ort schon immer erträumt.
Henri Cartier-Bresson: Erster bezahlter Urlaub, Ufer der Seine bei Juvisy-sur-Orge, Frankreich, 1938, © 2024 Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos
Im Vordergrund lagert eine Familie im Gras, die Mutter halb sitzend, der Vater ausgestreckt, das Kind im Schatten eines kleinen Baums. Dahinter verläuft die Seine quer durchs Bild, das Wasser ruhig, spiegelnd. Am gegenüberliegenden Ufer erkennt man weitere Gruppen – winzig, aber doch deutlich als Menschen lesbar. Der Horizont ist niedrig gesetzt, der Himmel nur ein schmaler Streifen. Die Szene wirkt spontan und scheint zugleich durchkomponiert.
Cartier-Bresson, der als Mitbegründer der Agentur Magnum den Begriff des „entscheidenden Moments“ prägte, fing hier nicht nur ein Idyll ein. Sein Foto zeigt einen historischen Einschnitt: die Freizeit der Vielen, nicht mehr die Ausnahme der Wenigen. Der Blick des Betrachters gleitet über das Bild wie über eine kleine Bühne, auf der das neue Glück der Freizeit inszeniert ist – aber ohne Pose, ohne Pathos, wie es zeitgleich jenseits des Rheins zumindest in der offiziellen Propaganda üblich war.
Die Fotografie zeigt jedoch noch etwas anderes, Tieferes, das über die bloße Sicherung von Ferien hinausweist. Der Tourismus eines frühen Cook oder Stangen war immer auch Bildungsreise: nicht Müßiggang, nicht bloßer Genuss, sondern die angestrebte Weiterentwicklung zu einem besseren Ich. Ein Unterton, der auch in der nationalsozialistischen Bewegung „Kraft durch Freude“ noch mitschwang – dort als Rechtfertigung der Freizeit zur Erhöhung der Arbeitskraft. Doch spätestens jetzt, im Sommer 1938, tritt diese Begründung in der Realität in den Hintergrund: Hier ging es nicht mehr um Erziehung oder ideologische Formung, sondern schlicht um die Freude am Innehalten.
Cartier-Bressons Fotografie ist damit nicht nur Kunst, sondern auch Zeitzeugnis. Sie dokumentiert eine neue Normalität, die kaum älter war als das Bild selbst. Der Sommer 1938 war der erste, in dem Millionen französischer Arbeiter gesetzlichen Anspruch auf Ferien hatten – und zugleich der letzte vollständige Sommer vor dem Krieg. Wenige Monate später überrollte der deutsche Angriff auf Polen die fragile Ordnung Europas.
Der Zweite Weltkrieg brachte nicht nur Zerstörung, sondern auch eine neue technische Infrastruktur hervor. Militärische Transportflugzeuge wurden nach 1945 zu Passagiermaschinen umgebaut, internationale Flughäfen entstanden, die Routen verdichteten sich. Am Ende stand das atomare Zeitalter, die bipolare Weltordnung – und mit ihr der Beginn eines globalen Massentourismus in den freien Gesellschaften des Westens.
Doch davon im dritten Teil.